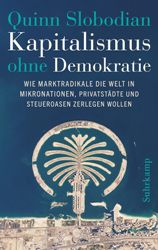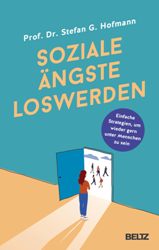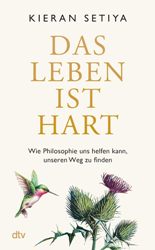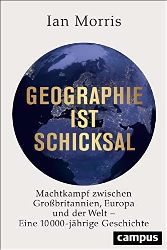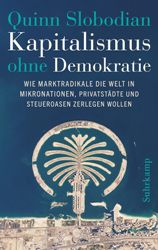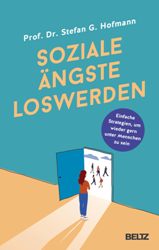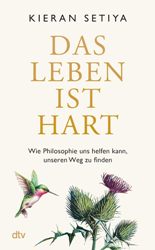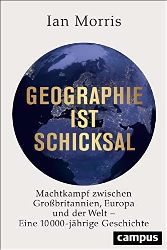Jaroslaw Kuisz, Karolina Wigura, Posttraumatische Souveränität (Edition Suhrkamp 2023
Rezensionen:
Ulrich M. Schmid, "Den politischen Schleuderkurs Polens verstehen", NZZ, 22. Januar 2024
Nicolas Freund, "Aufgerieben zwischen Imperien", Süddeutsche Zeitung, 21. November 2023
Judith Leister, "Posttraumatische Souveränität", SWR Kultur, 6. Februar 2024
Quinn Slobodian, Kapitalismus ohne Demokratie (Suhrkamp 2023
Rezensionen:
Lennart Laberenz, "Lästige Limits", Süddeutsche Zeitung, 11. Januar 2024
Florian Meinel, "Das Wahnbild des freien Marktes", FAZ, 10. Januar 2024
Tom Wohlfahrt, "Fragwürdige Fluchtfantasien", taz, 7. Dezember 2023
Stefan G. Hofmann, Soziale Ängste loswerden (Beltz 2024)
Kieran Setiya, Das Leben ist hart: Wie Philosophie uns helfen kann, unseren Weg zu finden (dtv 2023)
Rezensionen:
"Wie umgehen mit Krankheit, Trauer, Niederlagen?", SWR Kultur, 15. Februar 2024
Maxime Pasker, "Von Ratgebern und Steinen", Spektrum der Wissenschaft, 12. April 2024
Ian Morris, Geographie ist Schicksal (Campus 2022
Rezensionen:
"Wege zur Weltmacht", Der Freitag, 19. Mai 2022
Nana Brink, "Politik verstehen - mit Hilfe von Landkarten", Deutschlandfunk Kultur, 11. Juni 2022